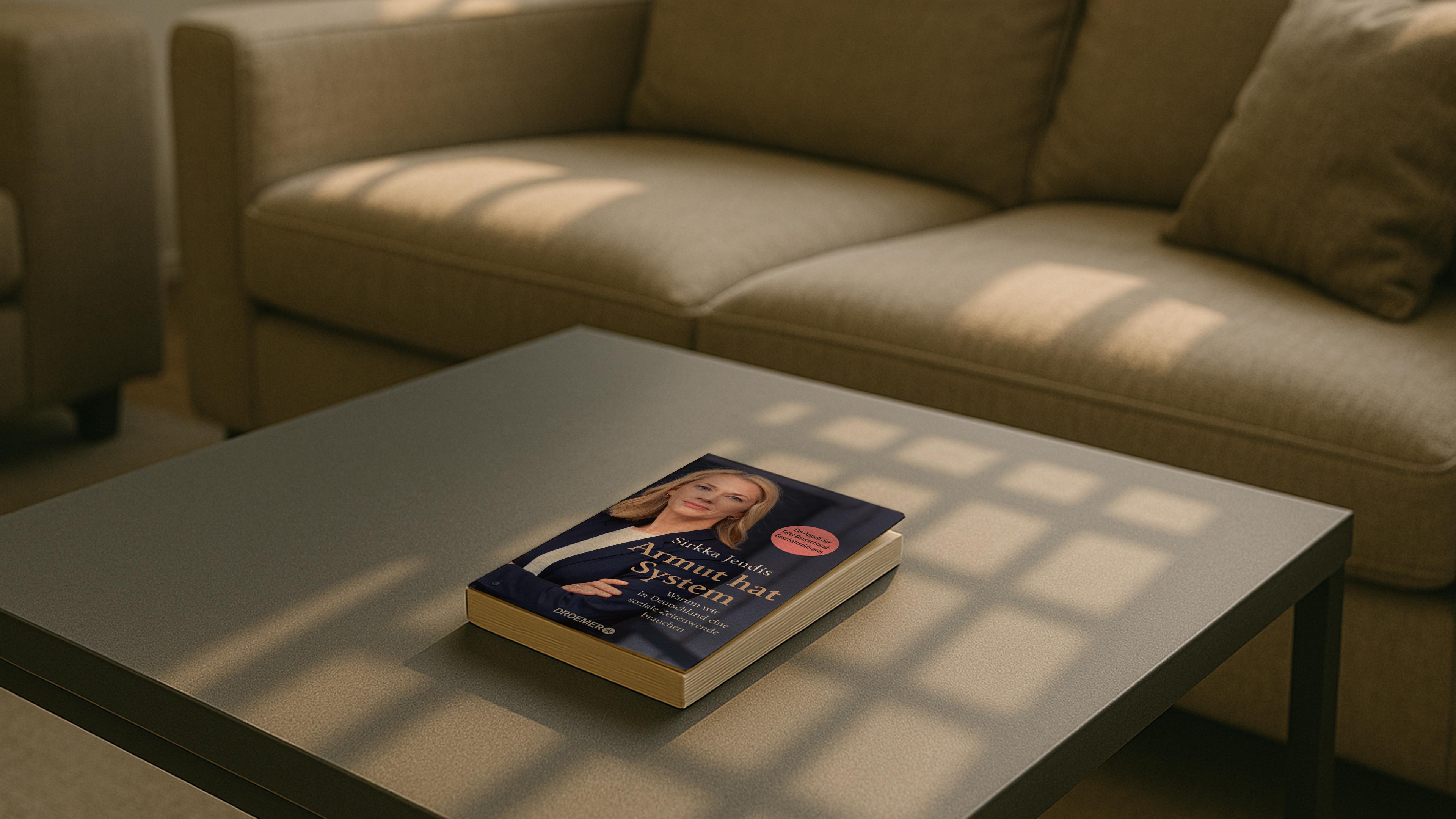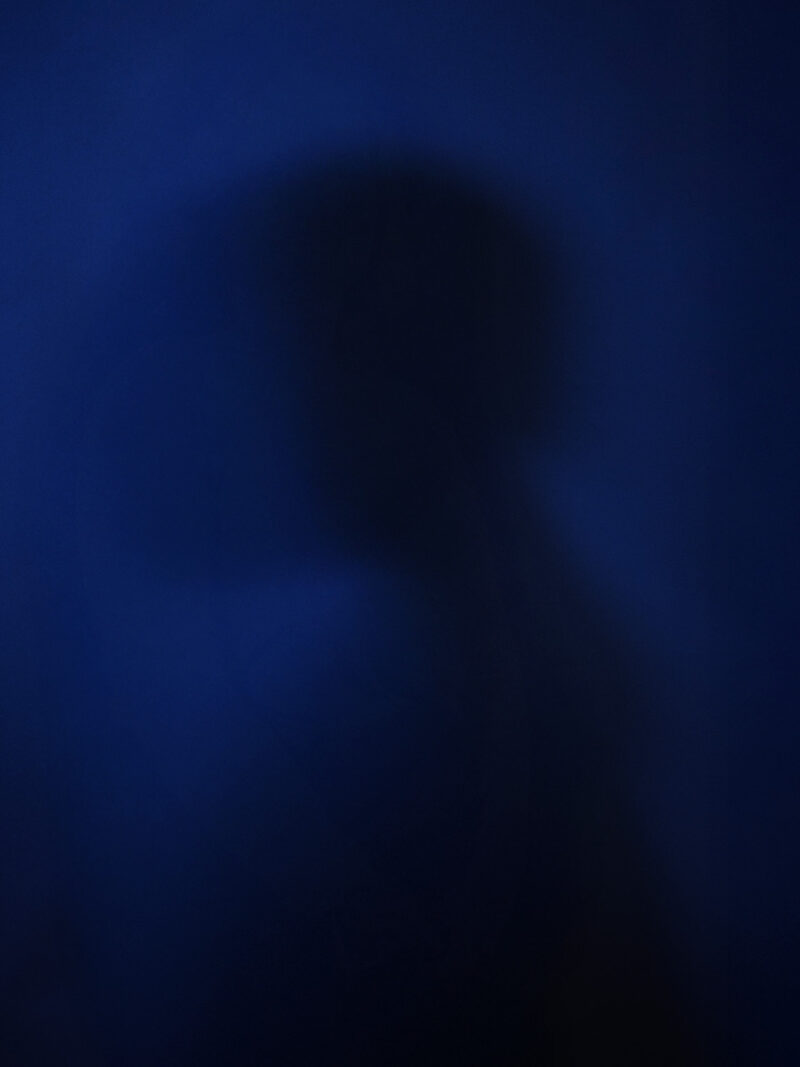- Projekt
- Chancen
Lebensqualitätsminimum

Veröffentlicht
24. April 2025
Methodik
Explorative Studie
Status
abgeschlossen
Ausgangslage
Erhöhte Bedarfe durch Krisen sowie Herausforderungen im Zuge der sozial-ökologischen Transformation belasten viele Haushalte in Deutschland maßgeblich. Zwar ist allgemein anerkannt, dass ein Mindestmaß an Lebensqualität unerlässlich ist, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen und aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben. Dennoch besteht kein allgemeiner Konsens darüber, wie genau ein solcher Lebensstandard aussehen sollte – und wie sich zusätzliche Bedarfe durch Einbezug von Transformations- und Nachhaltigkeitsaspekten auswirken.
Der politische und gesellschaftliche Diskurs greift oft auf relative Konzepte wie soziale Schichten, Einkommensgruppen oder die Armutsgefährdungsgrenze zurück. Diese basieren jedoch auf der aktuellen Einkommensverteilung und benennen somit lediglich relative Bedarfe. Für die Frage, welcher gesellschaftlicher Konsens über die tatsächlichen Bedarfe eines “angemessenen” Lebensstandards besteht, fehlen in Deutschland – im Gegensatz zu beispielsweise Großbritannien (Minimum Income Standard) – bislang robuste Erhebungen.
Projektziele
Ziel des Projekts „Lebensqualitätsminimum“ ist es zu ermitteln, welche finanziellen Bedarfe für ein selbstbestimmtes Leben in gesellschaftlicher Teilhabe bestehen – auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Transformationsaspekten. Damit zusammen hängt auch die Frage nach der passenden Erhebungsmethodik für ein nachhaltiges Lebensqualitätsminimum, welche möglichst ohne arbiträre Setzungen für verschiedene Konsumbereiche auskommt. Hierbei bieten Fokusgruppen-Workshops als deliberatives Element die Möglichkeit, einen breiteren gesellschaftlichen Konsens über tatsächliche Bedarfe zu erarbeiten und abzubilden.
Langfristig können die so ermittelten Zahlen für ein nachhaltiges Lebensqualitätsminimum als zentraler Orientierungsrahmen dienen, um geplante oder implementierte Policies im Sozial- oder Klimapolitikbereich daraufhin zu überprüfen, inwiefern sie sich tatsächlich auf die Möglichkeit eines angemessenen Lebensstandards auswirken. So können zum Beispiel gesellschaftliche und soziale Folgen von notwendigen Policies im Rahmen der sozial-ökologischen Transformation abgeschätzt, bewertet, diskutiert und kommuniziert werden.
In der Zukunft können die Ergebnisse einer so konzipierten Untersuchung helfen, politische Handlungsbedarfe und -spielräume bei der Gestaltung eines zukunftsfähigen Sozialstaats und des Strukturwandels hin zur Klimaneutralität zu bestimmen.
Die Frage nach den Bedingungen für ein Mindestmaß an Lebensqualität ist für die Gestaltung unseres Sozialstaates von zentraler Bedeutung. Für dessen Zukunftsfähigkeit müssen auch Mehrbelastungen im Zuge der sozial-ökologischen Transformation unbedingt mitgedacht werden.
Publikationen
- Policy Paper
Das Lebensqualitätsminimum
Bei Bürgergeld und Mindestlohn fehlen oft realitätsnahe Referenzwerte. Es braucht Daten darüber, was Menschen für ein angemessenes Leben benötigen. Mehr Beteiligung kann Bedarfe sichtbar machen und Entscheidungen legitimieren.
Jetzt lesen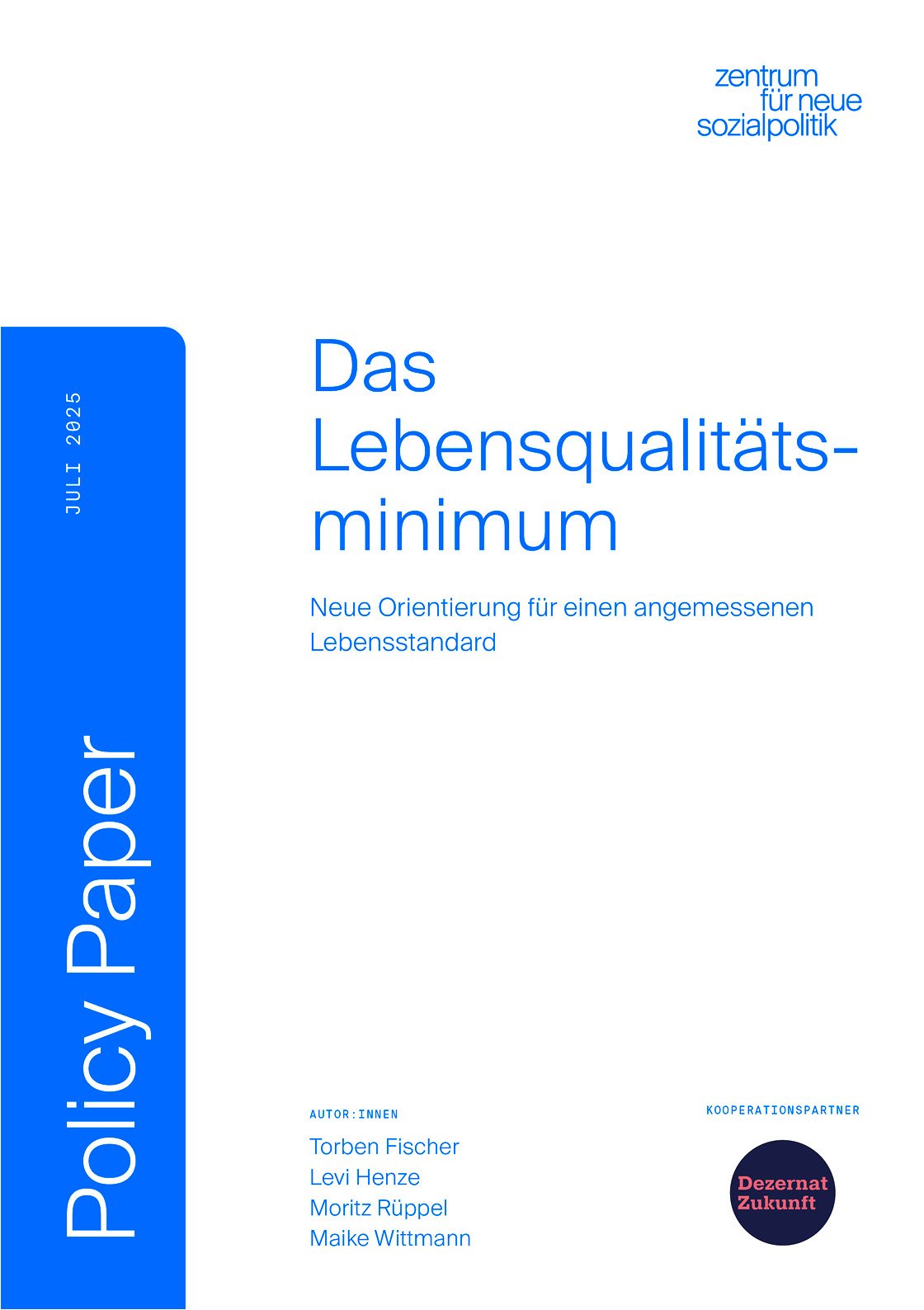
- Schlaglicht
Lebensqualitätsminimum in Deutschland
Was brauchen Menschen finanziell, damit sie angemessen leben können? Diese Frage versucht der Minimum Income Standard (MIS) in Großbritannien zu beantworten: In von Expert:innen unterstützten Fokusgruppen wird ein fiktiver Warenkorb mit Gütern und Leistungen erstellt, dessen Wert anschließend beziffert wird. So ergibt sich ein Budget für ein auskömmliches Leben. Für Deutschland fehlt es bislang an vergleichbaren Zahlen. Das will das Projekt Lebensqualitätsminimum ändern.
Jetzt lesen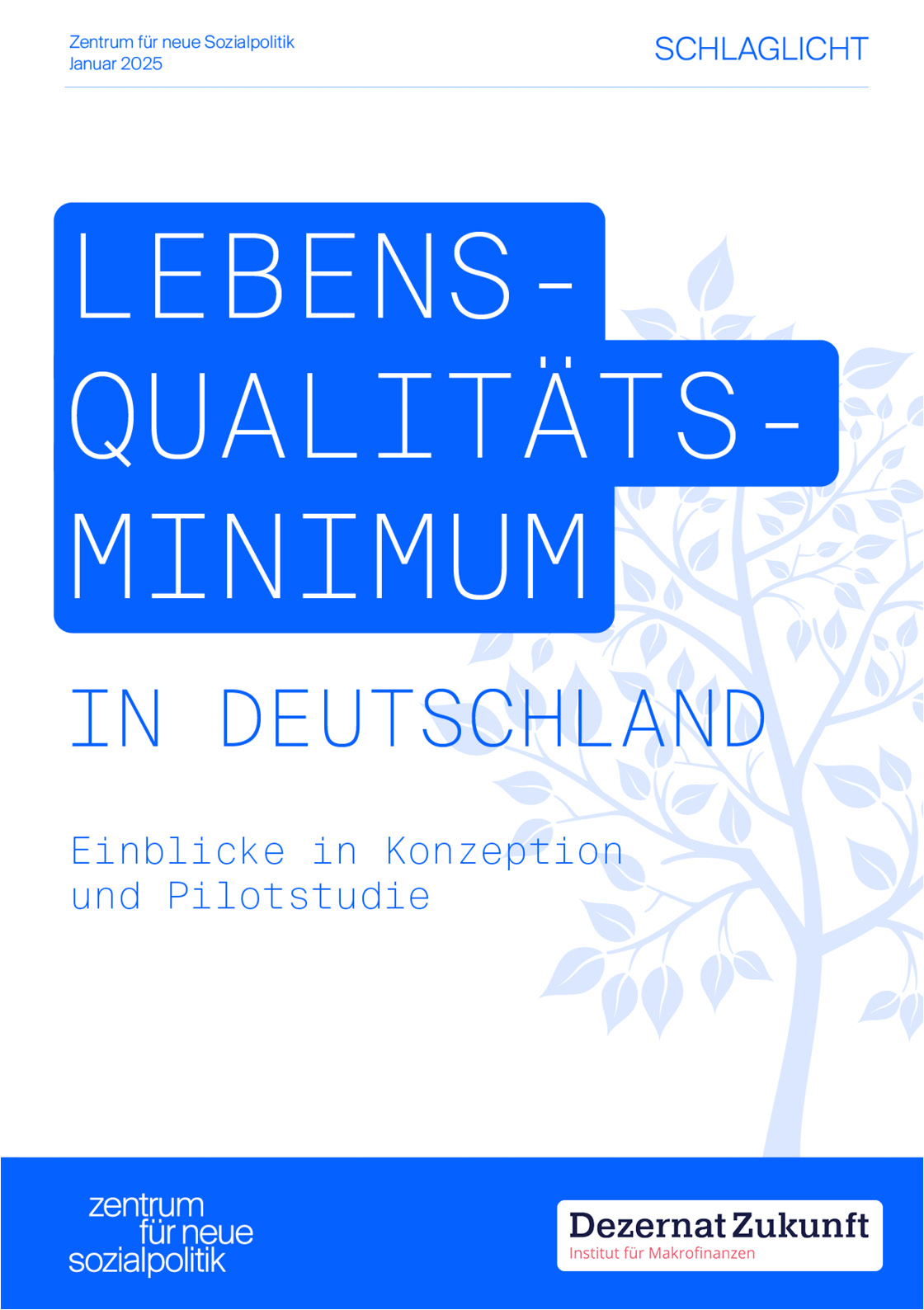
Blogbeiträge
Methodischer Hintergrund
Im Gegensatz zu sonst in diesem Bereich dominierenden Statistik-Methoden, wird im Zuge des Projekts eine Methodik mit deliberativen Elementen entwickelt, mit der Vorannahmen und arbiträre Setzungen (wie sie z.B. bei der Regelbedarfsermittlung getroffen werden) möglichst vermieden werden. Im Zentrum der Methode stehen Workshops mit Fokusgruppen unterschiedlicher Haushaltstypen, bei denen ein Konsens über die Erfordernisse eines nachhaltigen Lebensqualitätsminimums entlang verschiedener Konsumbereiche erarbeitet werden soll. Die erarbeitete Methodik wird exemplarisch für einige Haushaltsgruppen auf ihre Umsetzbarkeit hin getestet.
Die so konzipierte und getestete Methode soll auch in Bezug zu anderen Herangehensweisen diskutiert werden. So wird das Vorgehen des britischen Minimum Income Standard (kurz MIS) als eine Vergleichsgröße herangezogen. Hierfür werden Warenkörbe, die im MIS erarbeitet wurden, für die Situation in Deutschland “übersetzt” und mit den Ergebnissen zum nachhaltigen Lebensqualitätsminimum ins Verhältnis gesetzt.
Projektteam

Moritz Rüppel
Leitung Politik & Projekte
Moritz Rüppel leitet den Bereich Politik & Projekte. Im Fokus seiner Arbeit steht die politisch-strategische Ausrichtung des Bereichs, die proaktive Themensetzung der dort bearbeiteten Inhalte und der Transfer der Forschungsergebnisse in den parlamentarischen und vorpolitischen Raum.



Janek Steitz
Direktor Klima- und Industriepolitik
Janek Steitz ist Ökonom und Direktor beim Dezernat Zukunft, wo er die klima- und industriepolitische Arbeit leitet. Zuvor war er mehrere Jahre bei der Denkfabrik Agora Energiewende und in der Wirtschaftsberatung tätig.

Levi Henze
Ökonom Klima- und Industriepolitik
Levi Henze ist Ökonom beim Dezernat Zukunft. Seine Schwerpunkte sind die verteilungspolitischen und makroökonomischen Implikationen von Klimapolitik und Klimakrise. Er war zuvor Mitarbeiter im Abgeordnetenhaus von Berlin und hat dort haushaltspolitische Themen bearbeitet.