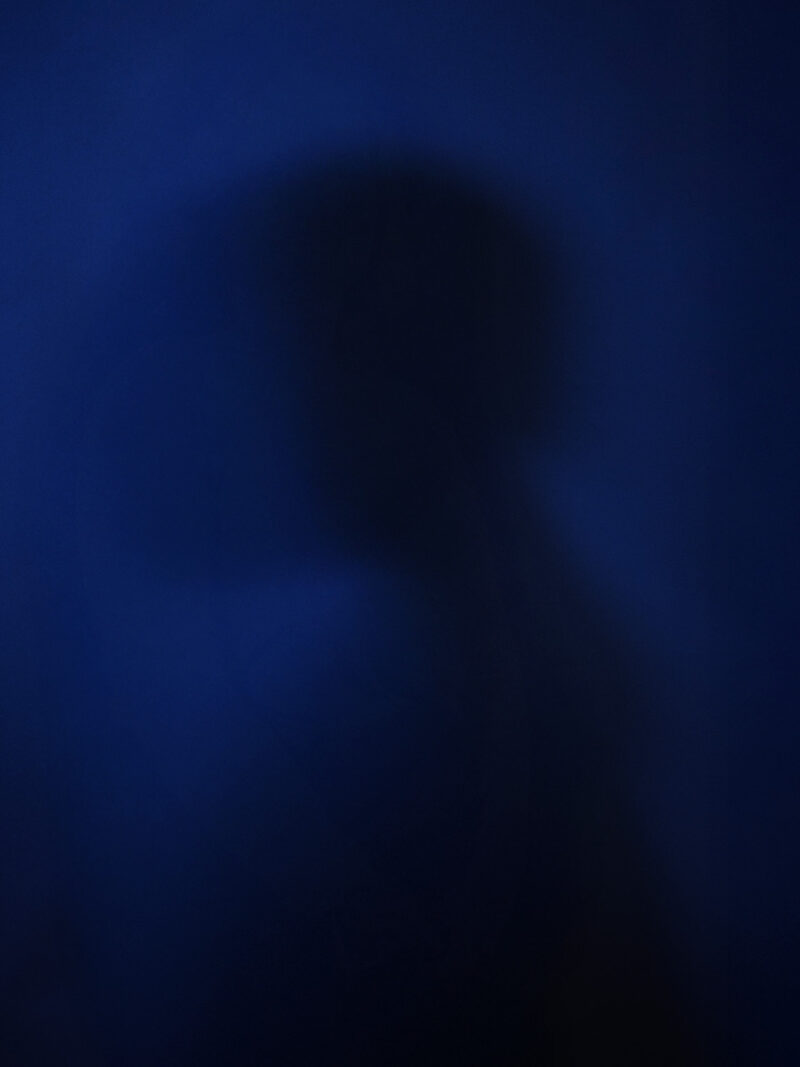- Blog
- Kommentar
Was der Sozialstaat leistet: Plädoyer für eine gesellschaftliche Errungenschaft

Vor dem „Herbst der Reformen“ droht der Sozialstaat auf seine Kosten reduziert zu werden. Doch moderne Sozialpolitik ist nicht nur ein Ausgabenposten. Sie leistet mehr, als ihr oft zugestanden wird - auch für die, die das System tragen.
Veröffentlicht
1. September 2025
Autor:innen
-
![]()
Dr. Dominic Afscharian
-
![]()
Nicholas Czichi-Welzer
Format
Kommentar
Der „Herbst der Reformen“ steht vor der Tür und klopft vor allem bei der Sozialpolitik an. Reformen sind ausdrücklich zu begrüßen: Viele Instrumente und Institutionen des Sozialstaats müssen modernisiert werden, um den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden. Bei allem, was der Sozialstaat bereits leistet, kann seine ermöglichende Rolle durch Reformen weiter gestärkt werden.
Doch anstatt Hoffnung zu wecken, setzt Bundeskanzler Friedrich Merz den Ton anders: Der heutige Sozialstaat sei „nicht mehr finanzierbar“ und von Worten „wie Sozialabbau und Kahlschlag“ lasse er sich bei seinem Vorhaben nicht irritieren. Diese Rhetorik verschiebt die Debatte gefährlich. Sie verstellt den Blick auf die vielen Funktionen des Sozialstaats, von denen die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite profitiert.
Wenngleich es Kritik am Sozialstaat schon immer gab, droht hier etwas ins Rutschen zu geraten: Wie selten zuvor in der deutschen Nachkriegsgeschichte steigt der Druck auf eine der großen Errungenschaften unserer Gesellschaft. Nahezu wöchentlich werden Säulen des gesellschaftlichen Zusammenhalts attackiert, für die jahrhundertelang gekämpft wurde. Das Problem liegt dabei nicht im Wunsch nach wirtschaftlicher Stärke oder individueller Freiheit. Beides sind legitime und wichtige Ziele. Es liegt darin, Sozialpolitik als deren Gegenspieler darzustellen. Tatsächlich schafft sie erst die Voraussetzungen dafür.
Team