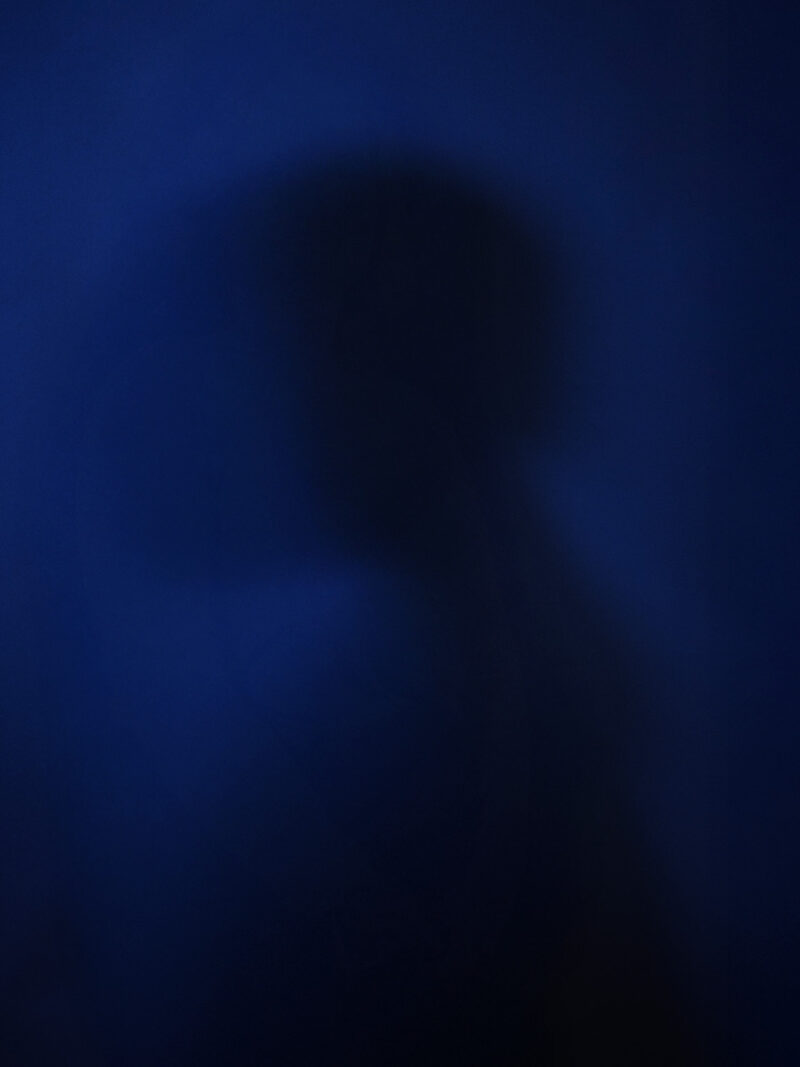- Schlaglicht
- Publikation
Bildung als Investition
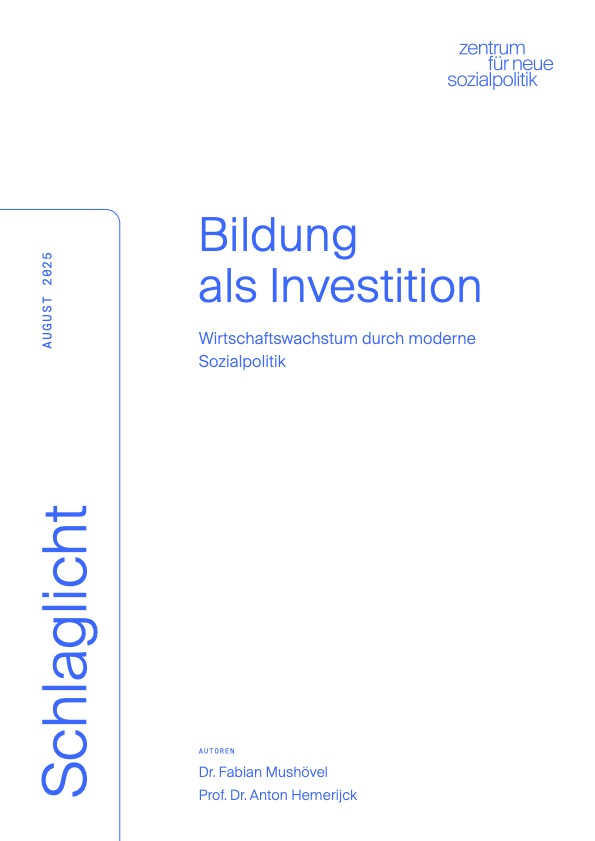
Veröffentlicht
29. Juli 2025
Autor:innen
-
![]()
Dr. Fabian Mushövel
-
![]()
Prof. Dr. Anton Hemerijck
Dr. Fabian Mushövel
Prof. Dr. Anton Hemerijck