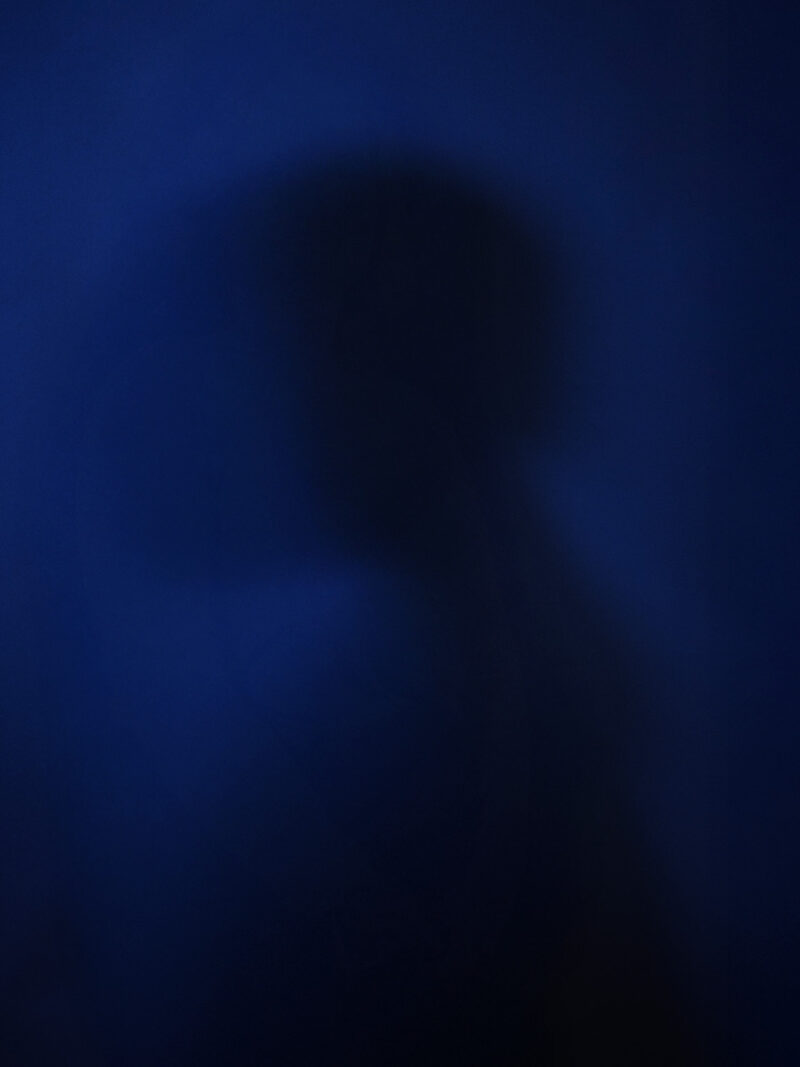- Blog
- Analyse
Sozialstaat unter Druck: Reformen, Kompromisse und offene Baustellen – eine Einordnung der aktuellen Vorhaben

Im „Herbst der Reformen“ nimmt die Politik den Sozialstaat ins Visier. Von Rente über Steuern bis Bildung und Pflege: zahlreiche Maßnahmen sind angekündigt, viele Kommissionen eingesetzt. Wir zeigen, was hinter den Vorhaben steckt, welche Ideen außerdem kursieren und welche Chancen und Risiken darin liegen.
Veröffentlicht
8. September 2025
Format
Analyse
Mit dem von Friedrich Merz ausgerufenen „Herbst der Reformen“ steht der Sozialstaat erneut im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit. Die Alterung der Gesellschaft, steigende Sozialausgaben, Fachkräftemangel und wachsende Akzeptanzprobleme setzen das bestehende System zunehmend unter Druck. Reformen sind daher nicht nur wünschenswert, sondern unvermeidlich. Bleiben sie aus, verliert der Sozialstaat an Wirksamkeit, Finanzierbarkeit und letztendlich an gesellschaftlicher Legitimation.
Die entscheidende Frage ist jedoch, welche inhaltliche Richtung diese Reformen einschlagen. Ein Kurs, der sich auf fiskalisches Klein-Klein und kurzfristige Sparmaßnahmen beschränkt, würde die strukturellen Herausforderungen nicht lösen und könnte das Vertrauen weiter schwächen. Notwendig ist vielmehr eine umfassende Modernisierung, die den Sozialstaat als Ermöglichungs- und Investitionsrahmen versteht: für Teilhabe, Wirtschaftskraft, Innovationsfähigkeit und gesellschaftliche Resilienz.
Dieser Beitrag nimmt die angekündigten Reformfelder in den Blick: von steuerfinanzierten Sozialleistungen über die Rentenversicherung, die Einkommensteuer und die Bildungspolitik bis hin zu den Grundstrukturen des Sozialstaats. Er zeigt auf, welche Vorschläge tatsächlich Reformqualität haben und wo der „Herbst der Reformen“ Gefahr läuft, an seinem eigenen Anspruch zu scheitern.
Team

Franziska Viktoria Grünhardt
Alumni
Franziska Viktoria Grünhardt war von Juli bis September 2025 Praktikantin im Bereich Politische Kommunikation am ZSP.