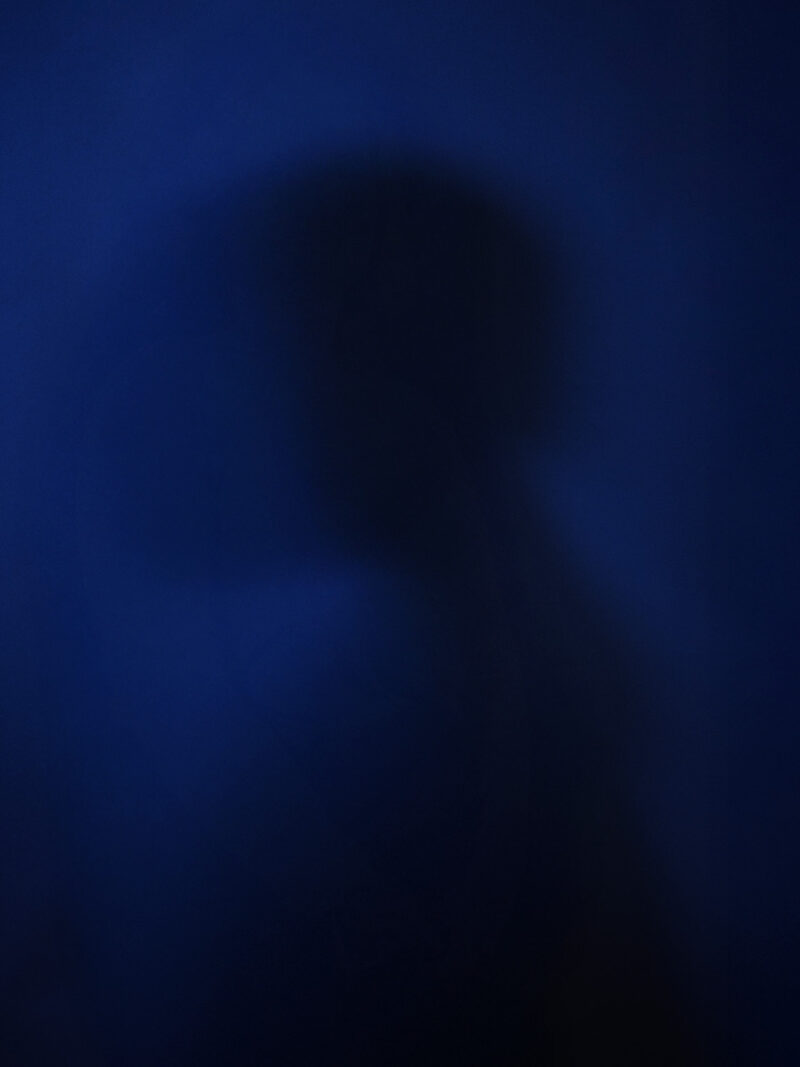- Blog
- Analyse
Sozialpolitik ist eine Investition
Wie sie Wohlstand sichern und Wachstum ankurbeln kann

Deutschland steht vor gigantischen Aufgaben, aber die finanziellen Spielräume sind begrenzt. Forderungen nach Sozialabbau werden daher lauter. Dieser Gastbeitrag zeigt, warum moderne Sozialpolitik Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist – wenn sie als Investition begriffen wird.
Veröffentlicht
20. Februar 2025
Autor:innen
-
![]()
Prof. Dr. Anton Hemerijck
-
![]()
Dr. Fabian Mushövel
Format
Analyse
Irrwege des Wahlkampfs
Deutschland wählt den nächsten Bundestag und alles dreht sich um Migration. Dabei steht das Land vor gewaltigen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Drei Säulen, auf die sich das deutsche Wachstumsmodell lange stützte, bröckeln: billige Energie durch russisches Gas, eine hohe Nachfrage nach deutschen Exportgütern sowie kostengünstige geopolitische Stabilität durch die Einbettung in das transatlantische Bündnis. Hinzu kommen diverse inländische Probleme. Die Energiewende muss weiter vorangetrieben werden, in der Digitalisierung hinkt Deutschland hinterher und es fehlen Investitionen in Infrastruktur. Demgegenüber stehen eine alternde Bevölkerung, ein übergroßer Niedriglohnsektor sowie hartnäckig fortbestehende Ungleichheit.
Kurzum, es braucht eine vollständige Neuausrichtung des deutschen Wachstumsmodells. Dieser Prozess dürfte enorm kostspielig werden. Wie, jedoch, soll ein Staat, der sich mit der Schuldenbremse selbst Fesseln ans Bein gelegt hat, dafür zahlen? Höhere Steuern sind für die Mehrheit der Menschen nach Jahren der Inflation nicht nur sozial ungerecht, sondern würden zudem die ohnehin schwache Binnennachfrage drücken. Auch eine stärkere Besteuerung von Unternehmen wäre im dritten Jahr in Folge ohne nennenswertes Wirtschaftswachstum ökonomisch kontraproduktiv. Die im Wahlkampf oft zitierte Lösung, man müsse bei der Sozialpolitik kürzen, würde bei weitem nicht die benötigten Mittel freigeben und ist angesichts der Tatsache, dass gut jeder fünfte Mensch in Deutschland von Armut betroffen ist, ohnehin problematisch.
Sozialpolitik ist eine Investition
Der Staat dürfe kein Geld ausgeben, das er nicht vorher eingenommen hat, argumentierte Friedrich Merz in einem TV-Duell mit Olaf Scholz (ZDF 2024). Sozialpolitik wird als reine Ausgabe verstanden, für die der Staat zunächst einmal Geld einnehmen muss. Was aber, wenn nicht Kürzungen, sondern schlicht eine bessere Gestaltung von Sozialpolitik der Schlüssel ist, soziale Gerechtigkeit mit Wachstum und höheren Steuereinnahmen zu verbinden? Den Diskussionen im Wahlkampf liegt ein veraltetes Verständnis von Sozialpolitik zugrunde. Zwar bekennen sich alle demokratischen Parteien zum Sozialstaat, er scheint jedoch als Luxus gesehen zu werden, den man sich in seiner jetzigen Großzügigkeit nur in guten Zeiten leisten kann.
In der Realität muss moderne Sozialpolitik vielmehr als Investition verstanden werden. Sie ist kein Nullsummenspiel, bei dem nur das ausgegeben werden kann, was vorher eingenommen wurde. Gut gestaltete Sozialinvestitionspolitik – sogenanntes Social Investment – führt zu höherer Produktivität, höherer Beschäftigung und letztendlich zu höheren Steuereinnahmen. Der Zusammenhang zwischen Social Investment und Wirtschaftswachstum wird deutlich, wenn wir den gesamten Lebenslauf eines Menschen betrachten: Sicherheit im Ruhestand hängt entscheidend vom Berufsleben ab, welches wiederum zu einem erheblichen Teil durch bessere Bildung sowie frühkindliche Betreuung bedingt wird. Wenn Menschen in jeder dieser Lebensphasen dabei unterstützt werden, ihr volles Potenzial zu entfalten, wirkt dies über den Lebenslauf als Multiplikator, der größer wird, je früher man im Leben ansetzt.
Dieser Zyklus beginnt mit adäquater Betreuung in der frühkindlichen Entwicklung, welche sich positiv auf den Erfolg junger Menschen in der schulischen Bildung auswirkt. Eine bessere Bildung wiederum schlägt sich in produktiveren und besser bezahlten Arbeitsverhältnissen nieder. Während des Berufslebens können Maßnahmen der Familienpolitik dazu beitragen, dass vor allem die systematische Benachteiligung von Frauen abnimmt, was über Erwerbsbeteiligung wiederum gesamtwirtschaftlich zu Wachstum führt. Mit steigendem Alter kann Sozialpolitik zudem durch lebenslanges Lernen, flexiblere Regeln für die Altersteilzeit sowie effektivere Pflegepolitik dafür sorgen, dass Menschen, so sie es denn können und wollen, länger die Möglichkeit haben, berufstätig zu sein. Wer also den deutschen Wohlstand nachhaltig fördern möchte, muss im gesamten Lebensverlauf in die Menschen investieren.
Übergänge zwischen Lebensphasen absichern
In jedem dieser Bereiche hat Deutschland großen Nachholbedarf und muss Übergänge zwischen den verschiedenen Lebensphasen besser unterstützen. In der Social Investment–Literatur spricht man hierbei von Flow Policies. Zur Veranschaulichung: Die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren lag 2024 bei gerade einmal 37%. Auffällig ist hierbei, dass die neuen Bundesländer über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit 55% eine um gut 20% höhere Betreuungsquote haben als die alten Bundesländer (Statistisches Bundesamt 2023a). Auch der schulische Erfolg von Kindern ist weiterhin vor allem vom Bildungsstand und Einkommen der Eltern abhängig. Die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuchs lag 2019 für Kinder, deren Eltern kein Abitur haben und ein Haushaltsnettoeinkommen von weniger als €2600 pro Monat verdienen, bei 21%. Haben hingegen beide Eltern Abitur und verdienen mehr als €5500 Euro pro Monat, liegt die Wahrscheinlichkeit bei gut 80% (ifo Institut 2023). Später im Lebensverlauf bestehen gravierende Ungleichheiten beispielsweise zwischen Männern und Frauen bezüglich der Betreuung ihrer Kinder. 2023 lag der Anteil von Müttern, die sich mit einem Kind unter drei Jahren in Elternzeit befanden, bei 44%. Für Väter lag dieser Anteil bei gerade einmal 3% (Statistisches Bundesamt 2023b). Zudem leisten Frauen generell gut 44% mehr unbezahlte Care Arbeit als Männer (bspw. Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen), was einem Mehraufwand von über 9 Stunden pro Woche entspricht (Statistisches Bundesamt 2024a). An all diesen Stellen könnte Sozialinvestitionspolitik ansetzen – etwa über eine effektivere Familienpolitik zum Zweck der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder eine bessere Pflegepolitik – und so nicht nur die soziale Ungleichheit bekämpfen, sondern gleichzeitig eine Erhöhung der Erwerbsquote sowie der Produktivität erreichen.
Bildung und Berufsqualifikation fördern
Neben der Erleichterung von Übergängen zwischen Lebensphasen muss Social Investment dafür sorgen, dass Menschen adäquat ausgebildet sind, was in der Literatur als Stock Policies bezeichnet wird. Das umfasst u.a. die Schulbildung, die Berufsausbildung und das Studium. Zwar gehört Deutschland in der Schulbildung nicht zur Weltspitze, es liegt aber weiterhin oberhalb des Durchschnitts in den OECD-Staaten, wie die Ergebnisse der PISA-Studien zeigen (OECD 2023a). Sein duales Ausbildungssystem dagegen ist nach wie vor eines der besten. Generell lässt sich konstatieren, dass das deutsche System in der beruflichen Erstausbildung durchaus erfolgreich ist (MIT Taskforce on Work of the Future 2020). In Zeiten des rapiden technologischen Wandels jedoch, in denen durch Innovationen wie den Einsatz künstlicher Intelligenz und Automatisierung ganze Berufszweige bedroht sind, wird Fort- und Weiterbildung massiv an Bedeutung gewinnen. Lernen muss zu einer lebenslangen Aufgabe werden und der Staat muss die Menschen und Unternehmen dabei unterstützen.
Auch hier bleibt in Deutschland großes Potenzial ungenutzt. In den letzten Jahren nahmen unter den 55-74-Jährigen knapp 3% an Weiterbildungen teil. In unseren europäischen Nachbarländern lag dieser Anteil weit darüber, in Österreich und Luxemburg bei etwa 6%, in den Niederlanden bei knapp 9% und in Frankreich bei 10%. Spitze sind die nordeuropäischen Staaten mit fast 20% in Dänemark und Schweden (Fernandes und Hemerijck i.E.). Zwar ist in Deutschland die Erwerbsquote bei Menschen ab 55 Jahren bereits relativ hoch (Statistisches Bundesamt 2023c), die Daten zeigen aber, dass effektiver gestaltete Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu einem Zuwachs an Produktivität und Wachstum führen würden. Schon eine bessere Koordinierung des unübersichtlichen Fort- und Weiterbildungssystems mit etwa 18.000 unabhängigen und größtenteils privaten Anbieter:innen (OECD 2023b) verspräche kostenschonend eine positive Veränderung.
Menschen gegen Risiken absichern
Trotz allem bleiben Absicherung und Umverteilung zentrale Aufgaben des Sozialstaats. Die oben beschriebenen Flow- und Stock-Maßnahmen entfalten nur dann ihr volles Potenzial, wenn Menschen durch großzügige Buffer abgesichert sind: Ein Mensch, der heute seine Arbeit verliert, weil die von ihm erlernten Skills auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr nachgefragt werden, benötigt Zeit und Ressourcen für Umschulungen und Weiterbildungen. Kann er während dieser Zeit seine Lebenshaltungskosten nicht decken, ist er gezwungen, eine Arbeit aufzunehmen, die wahrscheinlich schlechter bezahlt ist als die vorherige.
Der Staat spart in einem solchen Fall dann kurzfristig an Ausgaben für Arbeitslosengeld und Weiterbildungsmaßnahmen. Längerfristig entgehen ihm aber höhere Steuereinnahmen, wenn die betroffene Person nach abgeschlossener Weiterbildung eine produktivere und besser bezahlte Arbeit gefunden hätte. Wenn Politiker:innen also fordern, dass jede Arbeit besser ist als keine Arbeit, dann mag dies in seltenen Fällen, wenn z.B. der Sozialstaat missbraucht wird, richtig sein – im Gesamtbild ist dies allerdings kontraproduktive Wirtschaftspolitik. Tatsächlich hat Deutschland schon jetzt ein Problem mit der großen Zahl an Jobs, die den Menschen ein ungenügendes Einkommen bescheren und nur geringe Steuereinnahmen generieren. Allein die Zahl der geringfügig Beschäftigten liegt seit Jahren bei knapp 8 Millionen (Bundesagentur für Arbeit 2024). Jedes sechste Angestelltenverhältnis in Deutschland wird mit einem Niedriglohn vergütet. Für Erwerbstätige unter 25 Jahren lag der Anteil sogar bei 40%, für jene über 65 Jahren bei 37% (Statistisches Bundesamt 2023d).
Sozialpolitik in Zeiten knapper Kassen
Die kommende Bundesregierung wird Herausforderungen von selten dagewesenem Ausmaß meistern müssen. Zwangsläufig wird sie mehr Geld für Verteidigung, innere Sicherheit, Industriepolitik und Energiewende ausgeben müssen. Gleichzeitig hat sie wenig Spielraum für Steuererhöhungen oder nennenswerte Ausgabenkürzungen, um diese zu finanzieren. Wenn es der nächsten Bundesregierung ernst damit ist, dieses Dilemma zu lösen, ohne den deutschen Wohlstand zu gefährden, dann kann dies nur gelingen, wenn sie einen konsequenten Plan des nachhaltigen Wachstums verfolgt. Eine Neuaufstellung der Sozialpolitik hin zu Social Investment ist hierfür eine attraktive Lösung, die große Unterstützung bei den Wähler:innen findet: In einer aktuellen Umfrage des Zentrums für neue Sozialpolitik stimmten 80% der Befragten zu, dass Sozialpolitik einen wichtigen Beitrag dabei leisten kann, die deutsche Wirtschaft zu stärken (Afscharian 2024). Social Investment würde nicht nur nachhaltig die bestehende Ungleichheit im Land bekämpfen und für mehr soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit sorgen. Sie ist schlicht gute Wirtschaftspolitik, die es Deutschland erlauben wird, mit einer größeren, besser ausgebildeten und produktiveren Erwerbsbevölkerung global wettbewerbsfähig zu bleiben und dabei gleichzeitig weiter am Prinzip der fiskalischen Nachhaltigkeit festzuhalten.
Literatur
Afscharian, Dominic. 2024. „Kettensägen und Agendaträume – Brauchen wir die Superministerien?“ Zentrum für neue Sozialpolitik. https://zentrum-neue-sozialpolitik.org/kettensaegen-und-agendatraeume-brauchen-wir-die-superministerien/.
Bundesagentur für Arbeit. 2024. „Aktuelle Eckwerte zur Beschäftigung“. Bundesagentur für Arbeit. https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Beschaeftigung/Aktuelle-Eckwerte-Nav.html.
Fernandes, Daniel und Anton Hemerijck. (i.E.). „Social Investment Performance at a Glance“. In: Governing the Welfare Commons. Oxford: Oxford University Press.
Hemerijck, Anton, Stefano Ronchi und Ilze Plavgo. 2023. „Social Investment as a Conceptual Framework for Analysing Well-Being Returns and Reforms in 21st Century Welfare States“. Socio-Economic Review 21 (1): 479–500.
ifo Institut. 2023. „Der ifo – Ein Herz für Kinder: Chancenmonitor“. ifo Institut. https://www.ifo.de/publikationen/2023/aufsatz-zeitschrift/der-ifo-ein-herz-fuer-kinder-chancenmonitor.
MIT Taskforce on Work of the Future. 2020. „Research Brief: Ibsen & Thelen“. MIT Work of the Future. https://workofthefuture-taskforce.mit.edu/wp-content/uploads/2020/10/2020-Research-Brief-Ibsen-Thelen.pdf.
OECD. 2023a. „PISA 2022 Results (Volume I)“. OECD. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/pisa-2022-results-volume-i_76772a36/53f23881-en.pdf.
OECD. 2023b. „Continuing Education and Training in Germany“. OECD. https://www.oecd.org/en/publications/continuing-education-and-training-in-germany_1f552468-en/full-report.html.
Statistisches Bundesamt (Destatis). 2023a. „Betreuungsquote in der Kindertagesbetreuung“. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/Tabellen/betreuungsquote.html.
Statistisches Bundesamt (Destatis). 2023b. „Elternzeit“. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-3/elternzeit.html.
Statistisches Bundesamt (Destatis). 2023c. „Erwerbstätige und Erwerbstätigenquote“. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/erwerbstaetige-erwerbstaetigenquote.html.
Statistisches Bundesamt (Destatis). 2023d. „Niedriglohnquote“. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-2/niedriglohnquote.html.
Statistisches Bundesamt (Destatis). 2024a. „KORREKTUR: Gender Care Gap 2022: Frauen leisten 44,3 % (alt: 43,8 %) mehr unbezahlte Arbeit als Männer“. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/02/PD24_073_63991.html.
ZDF. 2024. „Bundestagswahl TV-Duell: Scholz und Merz über Migration, Brandmauer und Steuern“. ZDF. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/bundestagswahl-tv-duell-scholz-merz-migration-brandmauer-steuern-100.html.