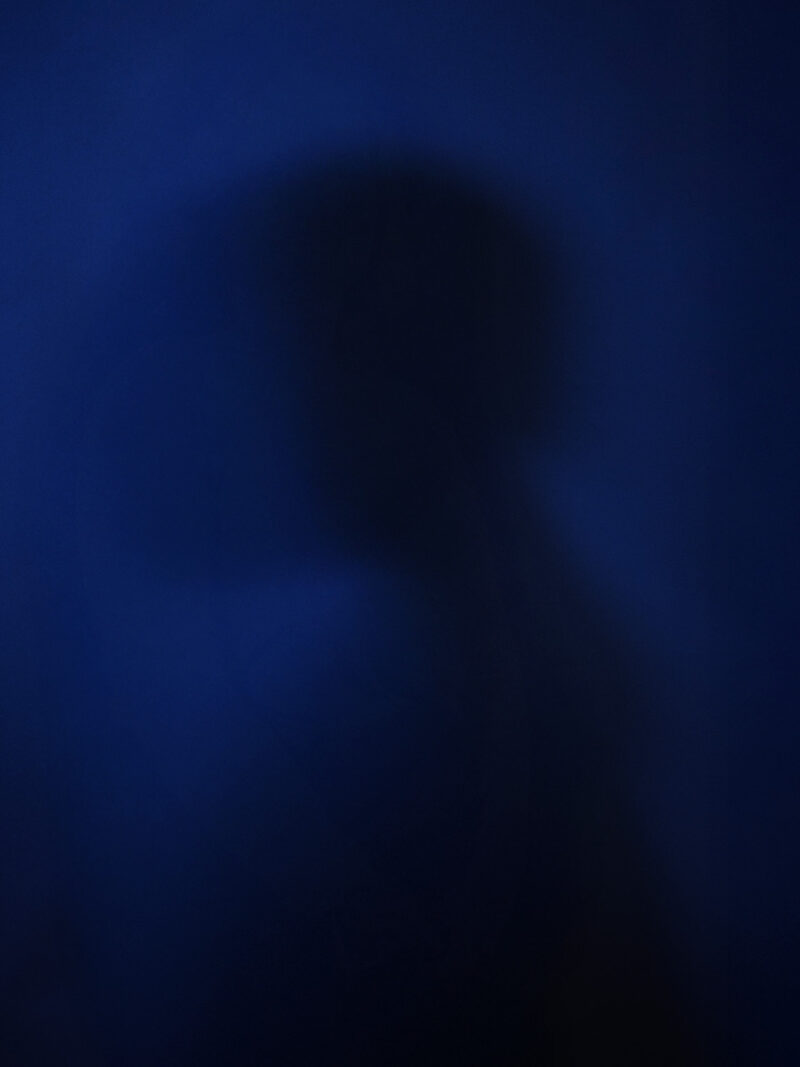- Blog
- Interview
GEG-Reform: Andere Debatte, gleiches Problem. Dr. Philip Rathgeb und Dr. Leonce Röth im Interview mit dem ZSP.
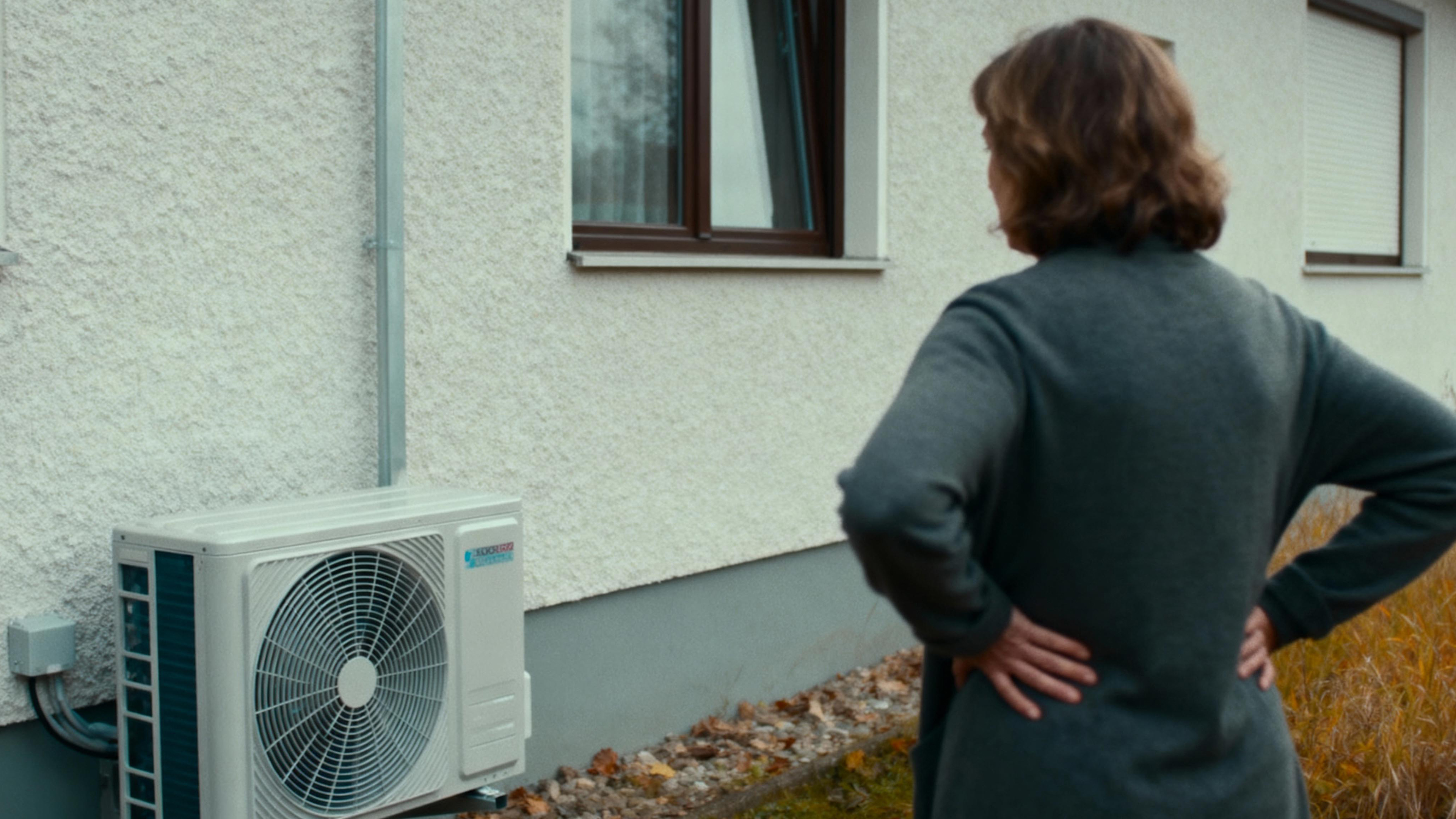
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde im Gesetzgebungsprozess 2023 von einer politisch aufgeheizten Debatte begleitet. Es wurde eines der umstrittensten Gesetze der Ampel-Regierung. Aktuell steht das GEG wieder weit oben auf der schwarz-roten Reformagenda während die Frage, wie eine ökologische Transformation auch sozial gelingen kann, dabei in den Hintergrund gerückt zu sein scheint.
Dr. Philip Rathgeb und Dr. Leonce Röth haben die GEG-Novelle der Ampel-Regierung in einem Schlaglicht hinsichtlich ihrer Verteilungswirkung und gruppenbezogenen Ansprache analysiert. Im Interview mit dem ZSP beleuchten sie die politische Kommunikation in der aktuellen Reformdebatte und kritisieren, dass die Regierung aus Union und SPD den sozialen Schwachstellen des GEG bisher wenig Aufmerksamkeit widmet.
Ausgangspunkt
Das GEG war eines der umstrittensten Gesetze der Ampel-Regierung und Gegenstand mehrerer Analysen. Was unterscheidet euren Ansatz von anderen Untersuchungen? Und was hat euch motiviert, diesen Zugang zu wählen?
Dr. Philip Rathgeb: Auf den ersten Blick könnte man meinen, zum GEG sei schon mehr als genug gesagt. Aus einer internationalen, vergleichenden Perspektive waren aber doch einige Aspekte interessant, die in der deutschen Debatte in unseren Augen zu kurz kamen. Überall in Europa stellt sich die Frage, wie eine ökologische Transformation auch sozial gelingen kann. Bei der Debatte um das GEG schienen sich allerdings unversöhnliche Positionen gegenüberzustehen, die in anderen Ländern weniger hitzig und recht pragmatisch verhandelt wurden – teils mit viel größeren Erfolgen.
Dr. Leonce Röth: Wir fragten uns also: Lag das am Gesetz selbst und/oder der Kommunikation? Es gab viele Analysen zum Gesetz und auch einige zur Kommunikation des Gesetzes – wir wollten beides verbinden und vor allem neuere Techniken nutzen, um den politischen Diskurs umfassend abzubilden. Dabei setzen wir große Sprachmodelle ein, die die politische Kommunikation über große Datenmengen hinweg – darunter Zeitungen, Pressemitteilungen von Parteien und Stellungnahmen von Interessengruppen – gruppenbezogen abbilden können. Mit einer solchen Analyse wird dann deutlich, wer sich wirklich für wen oder was einsetzt.
Erkenntnisse
Was sind die zentralen Erkenntnisse eurer Analyse – insbesondere mit Blick auf die soziale Dimension des GEG und seine Kommunikation?
Dr. Philip Rathgeb: Zunächst zeigt sich in unseren Augen, dass das GEG – und speziell der 2023 vorzeitig an die Öffentlichkeit geratene Entwurf – wichtige soziale Schwachstellen hatte. Nach unserer Analyse, und auch der einiger anderer Kolleg:innen, hat das Gesetz trotz sozialer Staffelung in der Förderung wichtige bedürftige Gruppen überfordert. Gleichzeitig wurde die Investitionsbereitschaft großer Teile der übrigen Bevölkerung falsch eingeschätzt. Die sozialen Schwachstellen des GEG wurden von den Befürworter:innen viel zu spät erkannt – und von den Kritiker:innen instrumentell ausgenutzt.
Dr. Leonce Röth: Wir empfehlen, Klimapolitik als Spannungsfeld zu verstehen, in dem CO2-Vermeidung, soziale Auswirkungen von Klimaschutz und fiskalische Spielräume mit Kompromissbereitschaft ausgehandelt werden müssen. Die Kritiker:innen hatten beim GEG das soziale und das fiskalische Argument auf ihrer Seite: Sie bezeichneten es als sozial unausgewogen und zu teuer. Unsere gruppenbezogene Analyse zeigt aber, dass das soziale Argument überwiegend instrumentell genutzt wurde. Es wurden starke Metaphern wie die der „sozialen Kälte“ oder der „sozialen Atombombe“ benutzt – ohne dass diese Rhetorik mit einem echten Einsatz für sozial schwache Gruppen unterlegt war. Sprich, eigentlich ging es den Kritiker:innen darum, hohe private und öffentliche Kosten zu vermeiden, und nicht um die soziale Schieflage. Aber aufgrund der Schwächen des Gesetzes und der Kommunikation konnten sie sich erfolgreich als Advokaten der „einfachen Leute“ präsentieren.
Welche Ergebnisse aus eurer Forschung waren für euch bemerkenswert oder haben euch besonders überrascht?
Dr. Philip Rathgeb: Mehrere Punkte. Erstens: Die sozialen Schwachstellen des frühen Gesetzesentwurfes waren frappierend – genau wie die lange Zeit, die es brauchte, bis die Grünen und die SPD diese wirklich realisierten. Die schwache Kommunikation der Befürworter:innen war letztlich eine Folge dieser späten Einsicht. Die Kritiker:innen waren hier deutlich schneller.
Zweitens waren wir überrascht von der anhaltenden Widersprüchlichkeit moderater Kritiker:innen wie CDU/CSU, FDP und auch vieler Medien. Mit Ausnahme der AfD und Teilen des BSW haben wir keine explizite Ablehnung der Klimaziele im deutschen Diskurs gefunden – weder in großen Medien noch bei den bürgerlichen Parteien. Gleichzeitig unterminierten dieselben Akteure aber ambitionierten Klimaschutz mit authentischen fiskalischen und vorgeschobenen sozialen Argumenten.
Dr. Leonce Röth: Wir hätten erstens erwartet, dass es in Teilen von Medien und Parteien offen formulierte Kritik an den Klimazielen gibt – das findet sich aber klar ausgesprochen nur bei der AfD und dem BSW. Zweitens hätte man vermuten können, dass die Widersprüchlichkeit zwischen dem Bekenntnis zu Klimazielen und der gleichzeitigen Blockade ihrer Instrumente stärker thematisiert wird. Und drittens hatten wir gedacht, dass die bürgerlichen Medien und Parteien stärker daran erinnert werden, wie massiv sie im GEG-Konflikt mit Begriffen wie „soziale Kälte” gearbeitet haben – obwohl dies heute, unter einer CDU/CSU-geführten Regierung, kaum mehr eine Rolle spielt.
Aktuelle Debatte
Im aktuellen „Herbst der Reformen“ steht das GEG wieder weit oben auf der politischen Agenda, und wie damals die Ampel-Regierung wirkt auch die Koalition aus Union und SPD uneins. Seht ihr Parallelen zur damaligen Situation, insbesondere in der Art, wie Parteien und Medien über das Gesetz kommunizieren? Oder steht uns eine andere Reformdebatte bevor?
Dr. Leonce Röth: Es gibt wichtige Parallelen, aber noch größere Unterschiede. Im Grunde haben sich die Positionen der Parteien kaum verändert, aber die Rollen schon: Die Union ist jetzt Regierungspartei. Sie bleibt ihrer dezidiert fiskalischen Kritik treu – das GEG sei zu teuer. Und wir sehen sehr deutlich, etwa in den Aussagen der Ministerin Reiche, dass es den Unionsparteien nicht um eine sozial ausgewogene Transformation geht. Das frühere Argument der „sozialen Kälte“ scheint vergessen.
Die SPD verteidigt im Grunde den Status quo. Sie fordert zwar weiterhin soziale Aspekte in der Klimapolitik ein, ist mit dem GEG aber weitestgehend zufrieden. Eine wirkliche soziale Vision der Transformation kommt von der SPD aber nicht. Inhaltlich ist also vieles ähnlich wie 2023, aber im Stil und der Sichtbarkeit verschiedener Akteure ist sie völlig anders. Umweltminister Schneider spricht deshalb von einer „entpolitisierten“ Debatte.
Dr. Philip Rathgeb: Das liegt daran, dass der größte Befürworter:innen ambitionierter Klimapolitik – und der zentrale Angriffspunkt der letzten Legislatur – wegfällt: die Grünen. Sie spielen derzeit in der Debatte kaum eine Rolle. Wenn es ihnen aber nicht gelingt, prominent in die Debatte einzusteigen und für ambitionierten Klimaschutz zu werben, und wenn es der Linken in Kombination mit den Sozialverbänden nicht gelingt, die soziale Dimension stark zu machen, dann kann die Union relativ widerstandsfrei versuchen, die Kosten des GEG zu drücken, während die SPD den Status quo verteidigt.
Auch weite Teile der Interessenverbände und der Wirtschaft unterstützen das GEG eigentlich grundsätzlich. Das alles spricht nicht für eine ähnlich spektakuläre Debatte, wie wir sie 2023 erlebt haben.
Aktuell setzt sich ein breites Bündnis aus Wohlfahrtsverbänden, Umweltorganisationen und Wirtschaftvertreter:innen dafür ein, dass die sozial-ökologischen Förderinstrumente des GEG nicht aufgeweicht werden. Welche Rolle können diese Akteure eurer Meinung nach im weiteren Gesetzgebungsprozess spielen, gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Skepsis gegenüber klimapolitischen Maßnahmen in der Bevölkerung?
Dr. Leonce Röth: Diese Akteure weisen auf wichtige soziale Schwachstellen in der Klima- und Energiepolitik hin – heute deutlich koordinierter und informierter als 2023, wo man den Eindruck haben musste, die GEG-Debatte traf sie recht unvorbereitet. Ironischerweise dringen ihre authentischen Positionen aber viel weniger durch als damals die instrumentell-sozialen Appelle der Kritiker:innen von Robert Habeck. Welche Rolle können sie also spielen? Ihr direkter Einfluss auf die SPD ist vermutlich größer als die Chance, über die Öffentlichkeit Druck auszuüben. Zwar reagiert die mediale Landschaft sensibel auf das Thema allgemein hoher Lebenshaltungskosten, doch lässt sich dezidiert soziale Bedürftigkeit schwierig mobilisieren.
Dr. Philip Rathgeb: Vielleicht bleibt zu erwähnen, dass die grundsätzliche Zustimmung zu Klimaschutz in Deutschland in vielen Umfragen hoch bleibt – aber die Bereitschaft, die dadurch entstehenden Belastungen zu tragen, ist niedrig.
Empfehlungen
Wenn ihr aus eurer Analyse eine Lehre für die aktuelle Reformdebatte zum GEG ziehen würdet, welche Empfehlung (für eine „gute“ Klimasozialpolitik) hättet ihr für die Regierungsparteien?
Dr. Philip Rathgeb: Eine gute Klimasozialpolitik muss clevere Integrationspunkte zwischen effektivem Klimaschutz, sozialer Verträglichkeit und fiskalischen Möglichkeiten finden. Die Fiskalseite und die Klimaseite haben starke Akteure, Ressourcen und hohe Sichtbarkeit – der soziale Aspekt ist unterrepräsentiert.
Ein Beispiel: Wir haben eine Vielzahl an Berechnungen von CO₂-Wirkungen kleinster Maßnahmen, wir haben auch kleinteiligste Analysen der fiskalischen Auswirkungen von Förderprogrammen. Aber wir wissen nicht, wie viele Vermieter:innen ein Nettohaushalteinkommen unter 40.000€ haben – also unterhalb der Grenze für die einkommensbasierte Förderung des GEG. Wir wissen nicht mal genau, aus welchen Einkommensgruppen die Förderung abgerufen wird, weil es diese Daten schlicht nicht gibt.
Dr. Leonce Röth: Vermutlich sind es mehr als 1 Million Vermieter:innen, vor allem alte Menschen, die die einkommensabhängige Förderung nicht in Anspruch nehmen können und damit mit einer maximalen Förderung von 30 % zurechtkommen müssen. Dazu kommt die Unsicherheit über zukünftige Energiepreise für Eigentümer:innen und Mieter:innen, die weiter mit fossilen Brennstoffen heizen, weil die Förderung sie nicht erreicht.
Kurz gesagt: Eine gute Klimapolitik muss sich erst einmal viel systematischer mit den sozialen Aspekten der CO₂-Reduktion beschäftigen, um clevere Gesetze zu entwickeln. Förderungen und Abschreibungen helfen, aber es wird ergänzend hohe öffentliche Investitionen brauchen, um einkommensschwache Haushalte bei der Energiewende mitzunehmen – das zeigen erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern.
Ausblick
Das Schlaglicht gibt einen Einblick in eure Forschung. Auf welche weiteren Schwerpunkte und Erkenntnisse dürfen wir uns aus dem Projekt freuen?
Dr. Leonce Röth: In einer erweiterten Analyse beziehen wir auch die Kommunikation von Interessengruppen und die fiskalischen Positionen der Akteure mit ein. Wir erläutern außerdem die Befunde und ihre methodischen Grundlagen ausführlicher. Letztlich entwickeln wir das GEG als Fallbeispiel für ein grundsätzliches Trilemma weiter: Klimapolitik bewegt sich immer zwischen effektiver CO₂-Reduktion, sozialer Verträglichkeit und fiskalischen Spielräumen.
Dr. Philip Rathgeb: Man kann schwerlich alle drei Ziele gleichzeitig voll erreichen, sondern muss einsehen, dass kluge Integrationspunkte gefunden werden müssen, die immer mit Konzessionen einhergehen. Derzeit gehen diese Kompromisse häufig zu Lasten der sozialen Verträglichkeit.