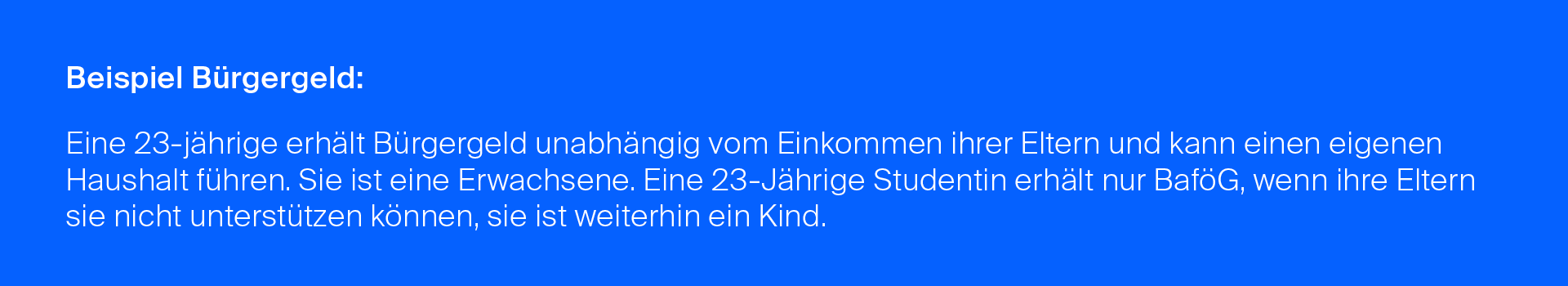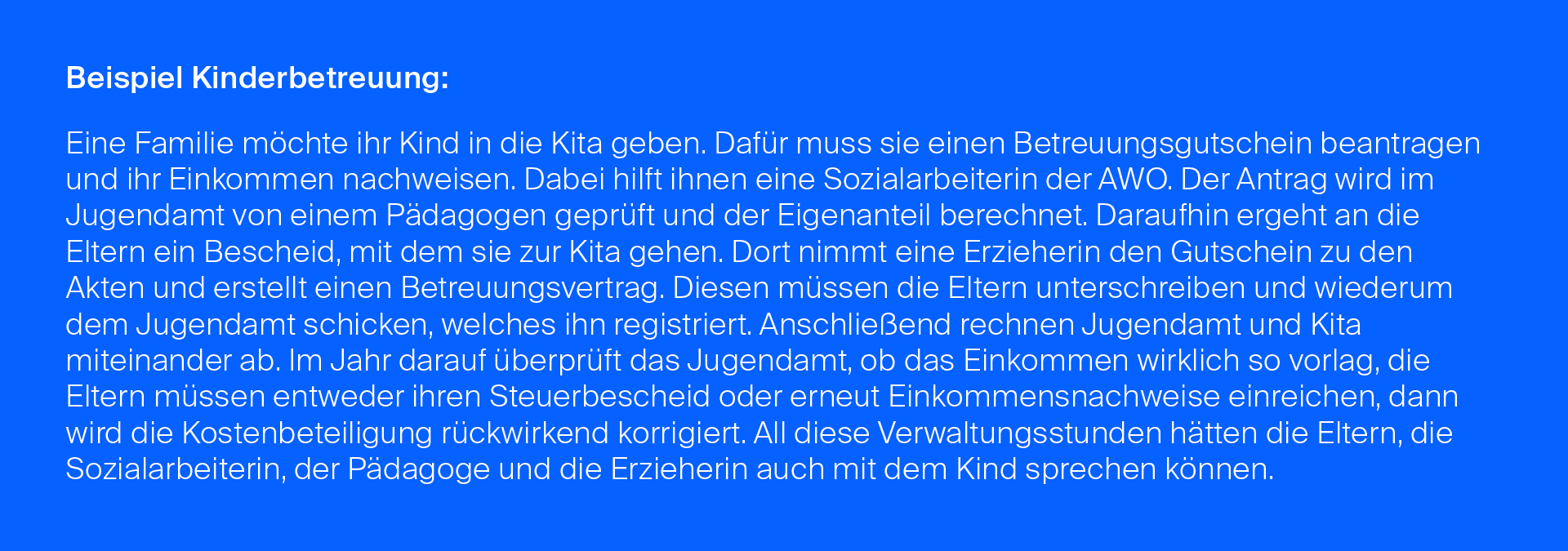- Blog
- Analyse
Ein Sozialstaat für das 21. Jahrhundert: Leistungen bündeln, Verwaltung zentralisieren, Kommunen entlasten

In der medial ausgetragenen Debatte darüber, ob wir uns den Sozialstaat entweder nicht mehr leisten können oder er im Gegenteil das Fundament unserer sozialen Marktwirtschaft bildet, geht ein entscheidender Punkt unter: die Chance, die eine große Koalition für eine grundlegende Sozialstaatsreform bietet.
CDU und SPD haben die einmalige Gelegenheit, den Dschungel der Leistungen zu lichten und die historisch gewachsenen Sonderleistungen zusammenzulegen. Eine zentralisierte Verwaltung bietet großes Einsparpotenzial, ohne die Leistungen für die Bedürftigen zu verschlechtern und ist aufgrund des Fachkräftemangels in den Kommunen unumgänglich. Die Digitalisierung ermöglicht diesen Schritt erstmals.
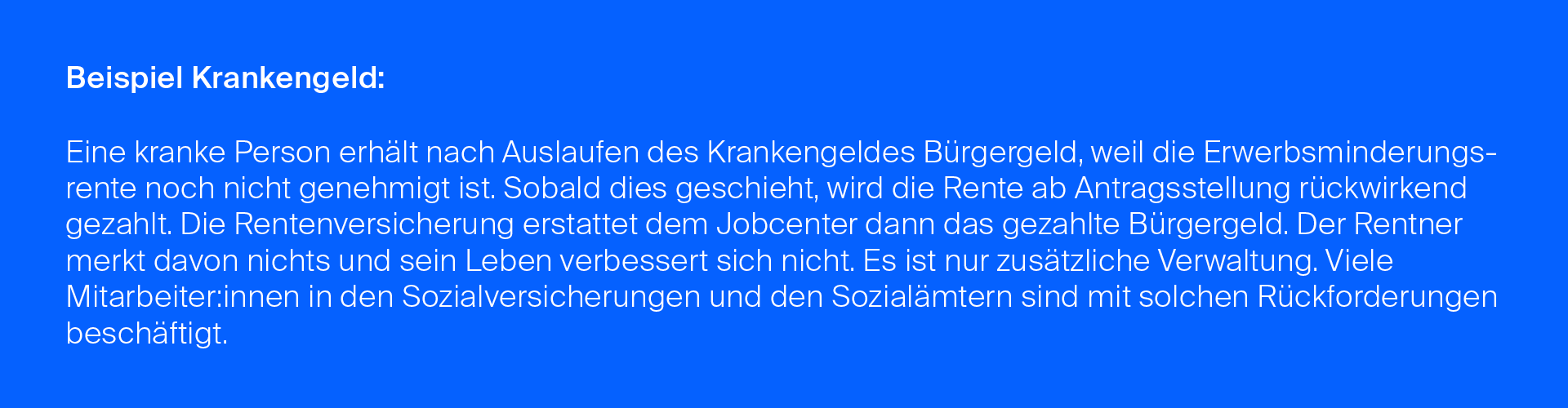
Ein ganzes Heer an Sozialarbeiter:innen und Sozialrechtsanwält:innen unterstützt bei der Beantragung von Sozialleistungen. Ein großer Teil der Sozialverwaltung ist damit beschäftigt, Geld untereinander zurückzufordern. Insbesondere die aufstockenden Leistungen kommen nicht bei den Berechtigten an, was zu einer faktischen Schlechterstellung von Arbeiter:innen im Niedriglohnbereich gegenüber einigen Sozialleistungsbezieher:innen führt. Diese Beispiele werden in den Medien ausgebreitet und führen zu einem verletzten Gerechtigkeitsgefühl.
Es ist das Resultat einer langen Geschichte der deutschen Sozialpolitik, die ihre Ursprünge in einer Zeit vor Internet, Telefon und Faxgerät hat. Die Kommunen sind historisch für die Sozialhilfen zuständig. Bürger:innen konnten dort vorsprechen und ihre individuelle Armut beurteilt werden. Inzwischen ist das System vollkommen durchreguliert, der individuelle Sachbearbeiter handelt nach bundeseinheitlichen Vorschriften.
[1] Der Regelsatz des Bürgergelds bildet die Grundlage für alle Leistungen, doch bei Detailregelungen – zum Beispiel zur Anrechnung eines KfZs als Vermögen – bestehen Unterschiede, die nicht sachgerecht sind.
[2] Das Krankengeld im wettbewerblichen System der gesetzlichen Krankenversicherungen führte in den letzten Jahren zu vielen Problemen und gesetzlichen Nachsteuerungen. Es dort rauszunehmen, wäre die einfachste Möglichkeit, diese zu adressieren.
[3] Bereits heute wird im Bürgergeld akzeptiert, dass Haushalte Teile der Mietkosten aus dem Regelsatz bezahlen, weil sie trotz Kostensenkungsaufforderung nicht umziehen (können). „Im Durchschnitt des Jahres 2024 überstiegen in rund 334 000 Bedarfsgemeinschaften die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung die anerkannten Kosten. Bezogen auf alle Bedarfsgemeinschaften mit laufenden anerkannten Kosten der Unterkunft entspricht dies einem Anteil von 12,6 Prozent.“ Quelle: Drucksache 21/1005